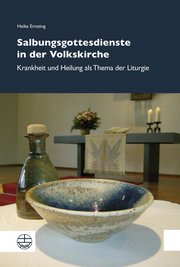Salbungs- und Segnungsgottesdienst
Die Salbung...
... als ein besonderes Segnungsritual in Gottesdienst und Seelsorge wird gegenwärtig in der evangelischen Kirche neu entdeckt. Die Salbung ist biblisch begründet und ökumenisch verbreitet, sowohl in der Orthodoxie als auch im römischen Katholizismus. Im Protestantismus war sie aus verschiedenen Gründen nahezu vergessen. Ihre Wiedergewinnung, ihr Verständnis und ihre verantwortliche Anwendung in der gottesdienstlichen und seelsorglichen Praxis der evangelischen Kirche sind zu begrüßen und zu fördern.
Zu den biblischen Wurzeln der Salbung
Jesus hat den Anbruch der Königsherrschaft Gottes nicht nur gepredigt. Sie hat sich durch sein Handeln in der Begegnung mit Menschen auch zeichenhaft verwirklicht, namentlich darin, dass er Sündenvergebung zugesprochen, Kranke geheilt und soziale Grenzen überwunden hat. Zu solcher Praxis hat Jesus auch seine Jünger angeleitet: „Geht aber und predigt: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus“ (Mt 10,7f.). Der entsprechende Ausführungsbericht liest sich bei Markus so: „Sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund“ (Mk 6,12f.). Und der auferstandene Jesus blickt in die Zukunft: „Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird’s besser mit ihnen werden“ (Mk 16,17f.).
Die Briefe des Apostels Paulus, speziell die Erwähnung der „Gaben, gesund zu machen“ (1Kor 12, 28.30), und die Apostelgeschichte des Lukas mit ihren Berichten über das Wirken der Apostel (vgl. Apg 3; 5,12-16; 9,32-35 u.a.) bestätigen, dass zu den Charakteristika der Jesus- und frühchristlichen Bewegung auch die Heilungstätigkeit zählte. In diesen Zusammenhang gehört der sprechendste biblische Beleg für die Salbung von Kranken mit Öl: „Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet“ (Jak 5,16-16a).
Öl ist in der Bibel wie in der Antike überhaupt ein Schutz- und Pflege-, Heil- und Genussmittel. In kosmetischer wie in therapeutischer Anwendung ist es ein Medium von Leben und Lebenskraft. Gegenüber der Handauflegung ist die rituelle Salbung mit Öl ein intensivierter Segnungsgestus – ein Segnen, das unter die Haut geht. Sie wird außer in der Konfrontation mit Krankheiten auch bei der Ermächtigung zu besonderen Aufträgen geübt; Propheten, Priester und Könige werden mit Öl gesalbt. Der „Messias“, der „Christus“ ist der „Gesalbte“. Nach den neutestamentlichen Belegen steht bei der rituellen Salbung mit Öl der Aspekt der Heilung im Vordergrund, jedoch, wie der Zusammenhang mit der Verkündigung des Reiches Gottes einerseits und der Sündenvergebung andererseits zeigt, in unlöslichem Zusammenhang mit dem Heil Gottes, das der ganzen Schöpfung gilt und den ganzen Menschen ergreift.
Zur gegenwärtigen Wiederentdeckung der Salbung
In der Frühzeit der Kirche gewann die im Neuen Testament noch nicht bezeugte Salbung vor und nach der Taufe eine herausragende Bedeutung. Die erst allmählich wieder aufkommende Krankensalbung verengte sich im Katholizismus des Hochmittelalters auf das Sakrament der „letzten Ölung“. Diese wurde von den Reformatoren abgelehnt, ihr sakramentaler Rang bestritten. Aber zu einer erneuerten Praxis der Krankensalbung, die dem bei Luther durchaus vorhandenen Bewusstsein von der „Guttat zu ölen“ entsprochen hätte, kam es in den evangelischen Kirchen nicht. Im Zuge von Rationalismus und Aufklärung vertiefte und verfestigte sich eine Trennung der Zuständigkeiten: Theologie und Kirche, Predigt und Seelsorge für die Seele, medizinische Wissenschaft und Praxis für den Körper.
Erst in jüngerer Zeit artikuliert sich auch in den westlichen Kirchen unüberhörbar und unabweisbar der Ruf nach einer ganzheitlicheren Wahrnehmung und Verantwortung des menschlichen als geschöpflichen Lebens. Darin wirken mehrere Faktoren zusammen, darunter die Begegnung und gegenseitige Herausforderung von Religionen und Kulturen, auch von unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen des Christentums selbst. So sieht sich die in ihrer Theologie und Praxis eher wort- und kopfbetonte westliche Kirche gegenüber stärker leibbezogenen Spielarten christlicher Lebenspraxis mit Potenzialen konfrontiert, die sie selbst vergessen oder verdrängt hatte.
Ökumenische Begegnungen, im Fall der Salbung mit Öl einerseits mit jungen Kirchen des Südens, in denen eine rituell bestimmte Heilungspraxis lebendig blieb, andererseits mit der anglikanischen Kirche, die sich der Krankensalbung schon früher wieder geöffnet hat, erschlossen auch den evangelischen Volkskirchen den Zugang zu eigenen verschütteten Quellen neu. Auch in der römisch-katholischen Kirche hat das II. Vatikanische Konzil die Krankensalbung aus ihrer Verengung zur „Letzten Ölung“ gelöst. Auf der anderen Seite war und ist ein wachsendes Bedürfnis der Menschen nach ganzheitlichen, nämlich leibliche, geistige und seelische Aspekte integrierenden Formen religiöser Vergewisserung zu registrieren – und ihre Bereitschaft, auch bislang ungewohnte Praktiken zu erproben, die solche Vergewisserung versprechen.
In dieser Situation sind Theologie und Kirche herausgefordert, die Salbung mit Öl als ein biblisch begründetes Segnungsritual theologisch zu verstehen und verantwortlich zu praktizieren. Nach evangelischem Verständnis tritt die Salbung nicht als ein Sakrament an die Seite von Taufe und Abendmahl, sondern ist eine das Gebet begleitende Intensivform des Segnens, bei der das Heil Gottes für einzelne Menschen nicht nur erbeten, sondern ihnen auch zugesprochen und in einer wohltuenden Geste leiblich zugewendet wird.
Gottesdienst und Seelsorge als Orte der Salbung
Schon in der Bibel begegnet die Salbung mit Öl – sei es als Krankensalbung, sei es als Ermächtigungshandlung für einen bestimmten Auftrag – vorwiegend als religiöses Ritual, d.h. als ein standardisierter symbolischer Vorgang, bei dem eine göttliche Mitwirkung erwartet wird. Dieser Vorgang bleibt freilich verbunden mit mehr oder weniger alltäglichen Lebensvollzügen, etwa mit dem nüchternen therapeutischen Handeln, wie es der barmherzige Samaritaner übt, indem er dem unter die Räuber Gefallenen „Öl und Wein auf seine Wunden“ gießt (Lk 10,34). Weniger alltäglich ist schon die Salbung der Füße bzw. des Kopfes Jesu durch eine Frau, wobei in dem hingebungsvollen Erweis von Liebe und Verehrung auch die Dimensionen von Auszeichnung und Beauftragung anklingen (Lk 7,37f; Mk 14,3 par. Mt 26,7; Joh 12,3). Und der Beter, der erklärt: „Du salbest mein Haupt mit Öl“ (Ps 23,5), bekennt, dass Gott ihm wohl tut und ihn an Leib und Seele beehrt. Noch in seiner rituellen Gestalt intendiert der Akt des Salbens das Wohlergehen und Wohlgefühl des Gesalbten.
Die biblische Notiz über die Ölsalbung vieler Kranker durch die Zwölf (Mk 6,13) verrät nichts über die Form, in der man sich diesen Vorgang vorzustellen hat. Dagegen begegnet an der klassischen Stelle in Jak 5 die Krankensalbung in einer ausgeprägt ritualisierten Gestalt. Es ist dort geregelt, dass die Ältesten der Gemeinde, also Funktionsträger, auf Anforderung tätig werden, und zwar nicht einzeln, sondern zu mehreren. Die Salbung mit Öl erfolgt hier ausdrücklich „im Namen des Herrn“ und steht in Verbindung mit Handauflegung und Gebet. Auch Sündenbekenntnis und Sündenvergebung werden in unmittelbarem Zusammenhang genannt.
Dem entspricht heute am ehesten der durch einen kranken Menschen selbst veranlasste Besuch einer Seelsorgerin oder eines Seelsorgers am häuslichen oder stationären Krankenbett. Allerdings steht der Mehrzahl der Gemeindeältesten in Jak heute zumeist die einzelne Seelsorgeperson gegenüber. Die durch die Mehrzahl der beteiligten Personen gegebene größere Öffentlichkeit – anders gesagt: die dadurch geminderte Privatheit – ist ebenfalls gewährleistet, wenn die Salbung im Rahmen eines öffentlichen Gottesdienstes stattfindet. Bei einer Salbung in gottesdienstlichem Rahmen muss freilich darauf geachtet werden, dass auch hier die Initiative wesentlich bei den Menschen, die gesalbt werden wollen, verbleibt und dass die Intensität der Zuwendung zu jedem einzelnen Menschen – und die Intensität des Gebetes über jedem einzelnen Menschen – nicht ungebührlich eingeschränkt wird. Das eine kann dadurch gewährleistet werden, dass zu Salbungsgottesdiensten eigens und ausdrücklich eingeladen wird – wer kommt, weiß, was ihn erwartet – und dass die im Verlauf des Gottesdienstes selbst ergehende Einladung, zur Salbung zu kommen, den Anwesenden alle Freiheit lässt, ihr auch nicht zu folgen. Das andere – die Intensität der Zuwendung – erfordert, dass es bei der Salbung auch im öffentlichen Gottesdienst zu einer gewissen Absonderung der einzelnen Personen kommt und dass für jede einzelne und jeden einzelnen genug Zeit zur Verfügung steht.
So bieten sowohl die Seelsorge als auch der Gottesdienst einen geeigneten Rahmen, in dem die Salbung mit Öl heute in unterschiedlich engem Bezug auf Jak 5 geübt werden kann. In der Klinikseelsorge können Seelsorge und Gottesdienst eng miteinander verbunden oder aufeinander bezogen werden.
Salbung und Sündenvergebung
In Jak 5 stehen mit der Salbung in engem Zusammenhang das Bekenntnis und die Vergebung der Sünden. Dies ist in Mk 6,13f. nicht ausdrücklich der Fall. Hier wie dort weist aber das Heil Gottes über alle „vorläufigen“ Gesundungen, in denen es sich leiblich, seelisch und/ oder sozial ereignet, hinaus. Das Heil Gottes hat als weitesten Horizont das Reich Gottes, in dem Sünde und Tod, Schuld und böses Geschick überwunden werden – für die Einzelnen wie für die gesamte Schöpfung.
In einem Salbungsgottesdienst kommen zeitliche und eschatologische Heilsverheißungen und -hoffnungen ebenso wie gegenwärtige Heils- und Unheilserfahrungen an mehreren Stellen zum Ausdruck: in Lesungen und Predigt, in Liedern, in Klage- und Bitt-, Lob- und Dankgebeten. Von Jak 5 her legt es sich nahe, ein ausdrückliches Sündenbekenntnis und eine darauf bezogene Vergebungszusage vorzusehen. Enthält das Bußgebet eine Stillephase, kann jede und jeder einzelne persönlich so, wie es für sie bzw. ihn richtig ist, bei Gott zu Wort kommen. Zu vermeiden sind Redeweisen, die die geheimnisvolle – und in der religiösen Auffassung vieler Menschen auch gefühlte – Korrespondenz zwischen Sünde und bösem Geschick entweder bagatellisieren oder konkretisieren. Richtungweisend ist Jesu Wort: „Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm“ (Joh 9,3).